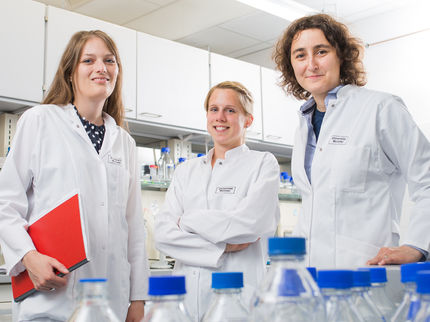Erster Nachweis von transport-korrelierten Protein-Wechselwirkungen in lebenden Zellen
n lebenden Zellen werden ständig Eiweiße (Proteine) und andere Zellbestandteile transportiert, nicht nur nach außen (Sekretion), sondern auch innerhalb der Zelle. Die meisten zellulären Proteine sind nicht gleichmäßig in der Zelle verteilt, sondern bestimmten Funktionsräumen oder Organellen, so genannten "Kompartimenten", zugeordnet. Diese Verteilungen sind nicht statisch, sondern ergeben sich aus einem sehr genau geregelten Fließgleichgewicht zwischen An- und Abtransport der Proteine. Der Transport der Proteine erfolgt in spezifischen Transportstrukturen, entweder in kleinen Bläschen (Vesikeln) oder in Röhrchen ähnlichen Strukturen (Tubuli). Wie die zu transportierenden Proteine in die jeweils richtig addressierten Vesikel oder Tubuli sortiert werden, wird gegenwärtig in mehreren Forschergruppen weltweit untersucht.
Der Nachweis, mit dem jetzt zum ersten Mal an den Transportprozess gekoppelte Protein-Protein-Wechselwirkungen in lebenden Zellen gezeigt wurden, ist das Ergebnis einer Kooperation von Wissenschaftlern aus drei Arbeitsgruppen, von Dr. Irina Majoul und Prof. Hans-Dieter Söling aus der Abteilung Neurobiologie am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, von Dr. Martin Straub und Pirv.-Doz. Dr. Stefan Hell aus der Arbeitsgruppe "Hochauflösende Optische Mikroskopie" am selben Institut, und von Dr.Rainer Duden aus dem "Department of Clinical Biochemistry" der Universität Cambridge, England. Untersucht wurde dabei der Transport eines bestimmten Rezeptors, des so genannten KDEL-Rezeptors "Erd2". Besetzt man diesen Rezeptor, der sich normalerweise im so genannten Golgi-Kompartiment aufhält, durch ein KDEL-Protein, so wird er rasch in Transport-Vesikel umsortiert, die den besetzten Rezeptor in ein anderes Kompartiment, das endoplasmatische Retikulum, transportieren. Diese Sortierungs-und Transportvorgänge beruhen auf sehr fein abgestimmten Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Regulatorproteinen. Um derartige Wechselwirkungen sichtbar zu machen, wurden in Cambridge spezifische Fusionsgene hergestellt, die, wenn sie in die Zelle gebracht werden, etwas veränderte Proteine erzeugen. Die mit solchen Fusionsgenen erzeugten Proteine unterscheiden sich von den an der Sortierung beteiligten Proteinen dadurch, dass sie an einem Ende noch ein zusätzliches Protein haben, das fluoreszieren, also leuchten kann. Man kann fluoreszierende Proteine mit unterschiedlichen spektralen Eigenschaften verwenden und dabei die Eigenschaften der fluoreszierenden Proteinanteile so wählen, dass die Fluoreszenz eines Proteins (das kürzere Wellenlängen absorbiert) ein anderes Fluoreszenzprotein (mit Absorption im langwelligen Bereich) zur Fluoreszenz anregt. Dieses Phänomen nennt man Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfer (FRET). Ein FRET-Phänomen lässt sich aber nur nachweisen, wenn beide fluoreszierende Komponenten (hier die beiden fluoreszierenden Fusionsproteine) sehr nah beieinander liegen (näher als 6 Nanometer = 6 millionstel Millimeter). Das Auftreten von FRET zwischen zwei Fusionsproteinen kann daher als Hinweis auf eine Interaktion dieser Proteine gewertet werden.