Spürnase für kanzerogene Stoffe in Lebensmitteln
Andrea Hochegger ist Analytische Chemikerin und untersucht an der TU Graz, ob Verpackungen und Produktion gesundheitsschädliche Stoffe an Lebensmittel weitergeben
Anzeigen
In den Fokus ihrer aktuellen Forschung stellt Andrea Hochegger vor allem die Kontamination mit Mineralölkohlenwasserstoffen. „Wir trennen die komplexe Mixtur in MOSH- und MOAH-Fraktionen“, erklärt die Forscherin. Dabei handelt es sich um Gruppen von chemischen Verbindungen, die in Mineralöl vorkommen. MOSH steht für gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (engl. Mineral Oil Saturated Hydrocarbons). MOAH für aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (engl. Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons).
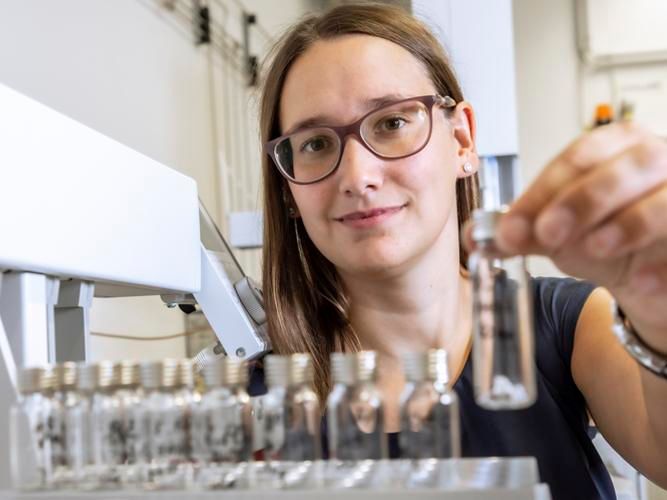
Andrea Hochegger im Labor.
Lunghammer – TU Graz
Die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus sind noch nicht weitgehend erforscht. Sicher zu sein scheint aber, dass MOAH-Fraktionen krebserregend sind und daher nicht in Lebensmitteln enthalten sein sollen. Nach ihnen sucht Andrea Hochegger unter anderem. „In Lebensmittel können zum Beispiel Rückstände aus der Produktion sein, wie Schmiermittel von Maschinen oder Produktionshilfsstoffe. Verunreinigungen können aber auch aus der Verpackung kommen“, erklärt Andrea Hochegger. „Mitunter sind diese Stoffe kanzerogen – können also Krebs auslösen.“ Sie untersucht dabei das gesamte Spektrum an Lebensmittel – von trockenen wie Reis und Mehl, über Speiseöle und Fette bis hin zu Fertigprodukten. Sie gibt auch wichtigen Input an Hersteller, über mögliche Kontaminationsquellen und wie man diese vermeiden kann. Und geht noch einen Schritt weiter: „Diese Stoffe bestehen aus tausenden unterschiedlichen chemischen Verbindungen und es ist nicht klar, welche davon kanzerogen ist.“ Dem möchte die junge Forscherin auf den Grund gehen. Ihr Wissen bringt sie aber auch bei der Zusammenarbeit mit internationalen Gremien ein „Wir haben an einer neuen Norm zur Bestimmung von MOSH und MOAH in Fetten und Ölen mitgearbeitet, die hoffentlich noch im Frühjahr 2023 veröffentlich werden kann.“
Praktikum in der Zellstofffabrik
Das Interesse an der Analytischen Chemie entwickelte Andrea Hochegger während eines Ferialjobs in einem Labor für Lebensmittelverpackungen in ihrem Heimatort – einer bekannten Zellstofffabrik. Aufgabe war es damals, eine Hochleistungsflüssigkeitschromatographie(HPLC)-Methode zur analytischen Identifikation von Substanzen zu entwickeln. Ihre Dissertation schrieb die 28-jährige gemeinsam mit dem Institut für Biobasierte Produkte und Papiertechnik zum Thema funktionelle, biobasierte Barrierestoffe, die Papierverpackungen undurchlässig für unter anderem Lebensmittelaromen, Kontaminationen oder Feuchtigkeit machen.
Lebensmittelverpackungen recyceln
Projektpläne für die zukünftige Forschungsarbeit gibt es bereits: Es soll um Lebensmittelverpackungen und das Recycling von Plastik gehen. „Das große Problem ist: Je öfter wir einen Stoff recyceln, desto mehr Kontaminationen entstehen oder können eingebracht werden.“ Außerdem sei Plastik nicht gleich Plastik – es gibt eine Vielzahl an möglichen Materialien und Materialkombinationen. Einfacher sei dieses Problem etwa bei PET-Trinkflaschen, die in einem Closed-Loop-Verfahren wieder zu Trinkflaschen verarbeitet werden. „Deshalb ist PET das am meisten recycelte Plastikmaterial im Lebensmittelkontakt.“ Bei anderen Materialien – etwa Folien für Obst oder Gemüse im Supermarkt – sei das schon komplizierter handzuhaben. „Hier ist kein geschlossener Kreislauf möglich. Diese Materialien sind hochkomplex und hochspezifisch. Jedes Produkt ist aus unterschiedlichen Polymeren teils in mehreren Schichten verarbeitet, die jede einzeln für den Schutz des Aromas, vor Wasser, Sauerstoff und ähnlichem zuständig sind. Das Recyceln wird dadurch erheblich erschwert.“
Ihre Zukunft will sie also ebenfalls in der Forschung verbringen und arbeitet auf eine Laufbahnstelle hin. „Ich liebe die Kombination aus Forschung und Lehre. Besonders die Grundlagenlabore im ersten Semester – es ist schön und spannend dabei zu sein, wenn die jungen Studierenden zum ersten Mal in einem richtigen Labor stehen“, strahlt sie.
Bis zum nächsten Projekt hat die Forscherin aber noch etwas Zeit. Und gerade hat sie ein Haus gebaut. „Hier beginnt für uns gerade die schöne Phase – mit Garten, Grillen und Natur.“































































