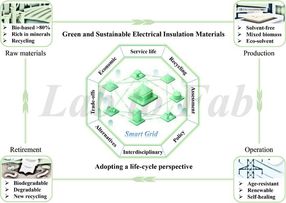Mit Supersäuren gegen Ewigkeitschemikalien
TU Berlin stellt Silizium-basierte „Lewis-Säuren“ her, die die Problemchemikalie PFAS angreifen können
Anzeigen
Forschenden des Katalyse-Exzellenzclusters UniSysCat der TU Berlin ist es erstmals gelungen, eine bereits theoretisch vorhergesagte Klasse von sogenannten Super-Lewis-Säuren herzustellen, die das Element Silizium sowie ein Halogenatom enthalten. Diese Verbindungen gehören zu den stärksten bisher hergestellten Lewis-Säuren und können auch sehr stabile chemische Bindungen aufbrechen. Damit sind sie von großem Interesse für Recyclingprozesse und das Konzept der Grünen Chemie, beispielsweise für den Abbau von gesundheitsschädlichen per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), auch bekannt als „ewige Chemikalien“. Das Besondere: Durch einen Kreislaufprozess innerhalb der Abbau-Reaktion werden diese Lewis-Säuren nicht verbraucht und könnten daher zukünftig wie Katalysatoren wirken. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Nature Chemistry veröffentlicht.

Immer wieder werden in Deutschland Orte entdeckt, die mit hohen Konzentrationen von PFAS kontaminiert sind (Symbolbild).
PFAS kann man nicht riechen oder schmecken und sie werden verdächtigt, Krebs zu verursachen, unfruchtbar zu machen und das Immunsystem zu schwächen. Wenn sie einmal in die Umwelt gelangt sind, bleiben sie dort für sehr lange Zeit, denn die Stoffe können weder durch Wasser noch durch Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden. Gerade weil PFAS so beständig sind, werden sie vielfältig eingesetzt, etwa für Regenjacken, Pfannen oder Baustoffe. Und immer wieder werden in Deutschland Flächen entdeckt, die mit hohen Konzentrationen von PFAS kontaminiert sind.
Super-Lewis-Säuren können stabile Verbindungen der PFAS knacken
„Die Beständigkeit der PFAS steht in direktem Zusammenhang mit ihren stabilen Kohlenstoff–Fluor-Bindungen, die nur sehr schwer aufzubrechen sind“, erklärt Prof. Dr. Martin Oestreich, Inhaber einer Einstein-Professur an der TU Berlin und Leiter des Fachgebiets „Organische Chemie/Synthese und Katalyse“ sowie Mitglied von UniSysCat. Es ist vor allem die sogenannte Elektronenpaarbindung zwischen den Fluor- und den Kohlenstoffatomen in den PFAS, die besonders stark ist. „Um PFAS unschädlich machen zu können, benötigt man also einen Stoff, der sehr gerne Elektronenpaare aufnimmt“, so Oestreich. Solche Substanzen nennt man „Super-Lewis-Säuren“. Der Name „Lewis-Säure“ bezeichnet dabei keine bestimmten chemischen Verbindungen – wie Salzsäure, Schwefelsäure und so weiter – sondern steht für ein besonderes Konzept in der Chemie, die Begriffe „Säure“ und „Base“ zu definieren. Es wurde 1923 vom US-amerikanischen Physikochemiker Gilbert Newton Lewis entwickelt.
Irre Gier nach Elektronen
„Unsere Super-Lewis-Säuren enthalten neben zwei organischen Resten vor allem ein Siliziumatom, das zusätzlich ein Halogen, also etwa ein Fluoratom, trägt. Das führt zu einer irren Gier nach Elektronenpaaren“, sagt Oestreich. Gerade die Kombination aus dem sowieso schon elektronenhungrigen Siliziumatom und dem stark elektronenziehenden Fluor sei dabei entscheidend: „Das Fluor zerrt zusätzlich an den verbliebenen äußeren Elektronen des Siliziums – so wie ich mich nachts vollständig in die gemeinsame Bettdecke wickle, wenn meine Frau und ich in einem französischen Bett übernachten.“ Der Elektronenmangel führe beim Silizium zu einem extremen Hunger nach Elektronenpaaren – das damit zum perfekten Angreifer auf die PFAS wird.
Herstellung ist komplex
Bis vor kurzem wurden diese Super-Lewis-Säuren mit Silizium und Halogenen nur theoretisch vorhergesagt. Denn ihre Herstellung ist alles andere als einfach. Im Jahr 2021 gelang den Wissenschaftler*innen an der TU Berlin ein Durchbruch, als sie erstmals das Verfahren der „Protolyse“ zur Erzeugung von Super-Lewis-Säuren anwandten, bei dem in einem Zyklus einzelne chemische Gruppen von einer Verbindung abgetrennt werden, um eine neue zu synthetisieren. „Vereinfacht gesagt geht es hier darum, bewährte Prozesse aus der Kohlenstoffchemie auf die Siliziumchemie zu übertragen. Im Prinzip ernten wir jetzt die Früchte unserer damaligen Idee“, erzählt Martin Oestreich. Die Experimente waren aufwendig, weil alle Arbeiten in einer „Handschuhbox“ unter Schutzgasatmosphäre durchgeführt werden müssen, weder Sauerstoff noch Wasser dürfen mit den Substanzen in Berührung kommen.
Erstmals Verbindungen komplett quantenmechanisch verstanden
„Ganz besonders zu Dank verpflichtet bin ich Professor Martin Kaupp, dem Leiter des Fachgebiets ‚Theoretische Chemie/Quantenchemie‘ an der TU Berlin, ohne dessen Berechnungen diese Arbeit gar nicht möglich gewesen wäre“, sagt Oestreich. Erstmals seien quantenmechanische Rechnungen zum Einsatz gekommen, mit denen die Säurestärke der hergestellten Moleküle rein aus deren Struktur vorausberechnet werden konnte. „Wir haben die Verbindungen komplett quantenmechanisch verstanden, das ist ein Riesenvorteil.“ Experimentell wurden die Super-Lewis-Säuren dann unter anderem mit Hilfe von Kernresonanz-Spektroskopie (NMR) untersucht und die Berechnungen verifiziert.
Super-Lewis-Säuren werden als Katalysatoren nicht verbraucht
Der besondere Clou beim Abbau der gesundheitsschädlichen PFAS: Die Super-Lewis-Säuren werden zwar durch die Aufnahme von Elektronenpaaren beim Knacken einer Verbindung verändert – sie können sich jedoch voraussichtlich in einem Regenerationsprozess wieder in die ursprüngliche Super-Lewis-Säure verwandeln. Damit sind sie Katalysatoren, die bei der Reaktion zwar verbraucht, aber wiedergewonnen werden. Ein großer Pluspunkt – denn dann sind zum Abbau von PFAS-Kontaminationen nicht entsprechend große Mengen eines „Gegengifts“ notwendig, sondern kleinste Mengen der neuen Super-Lewis-Säuren würden ausreichen, um die Ewigkeitschemikalien unschädlich zu machen.