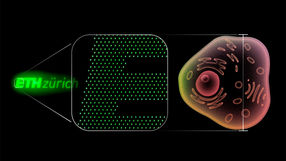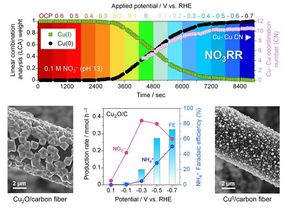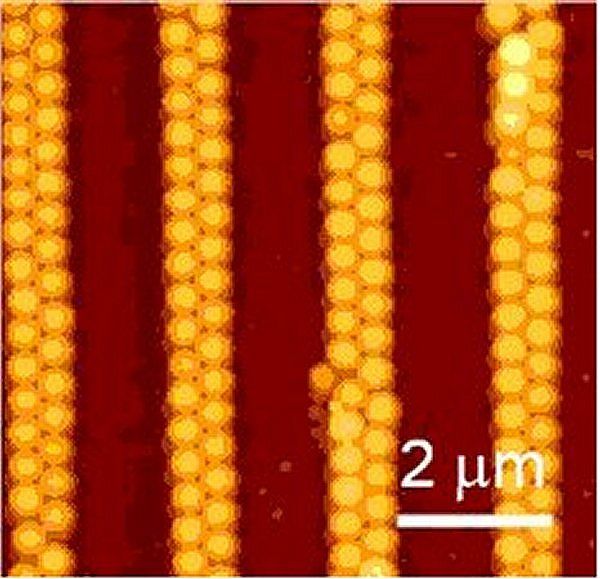Sprengen für die Werkstoffforschung
Anzeigen
Ein Forschungslabor für Materialsynthesen unter Tage wurde am 11. Juli im Lehr- und Forschungsbergwerk "Reiche Zeche" der TU Bergakademie Freiberg in Sachsen auf dem Fuchsmühlenweg feierlich eingeweiht. "Wir werden im neuen Schockwellenlabor Versuche zur Synthese und Umwandlung neuer Hochleistungswerkstoffe durchführen", erklärt Gerhard Heide, Professor für Allgemeine und Angewandte Mineralogie an der TU Bergakademie Freiberg.

Steiger Stephan Leibelt beim Zusammenbau einer Sprengladung.
TU Bergakademie Freiberg / Detlev Müller
Die bei der Detonation des Sprengstoffs erzeugten Druckwellen lösen in der Probe Umwandlungsprozesse aus, die für die Herstellung neuer, besonders fester Materialien entscheidend sind. Solche Prozesse sind auch in der Natur bekannt: Bei Meteoriteneinschlägen kann beispielsweise Diamant entstehen. "Die durch Schockwellen hergestellten Hartstoffe sollen optimale Eigenschaften erhalten, z.B. eine höhere Temperaturbeständigkeit als Diamant. Dann können sie in extrem harten Bohrköpfen in der Tiefbohrtechnik, aber auch zum Polieren optischer Gläser für Linsen von Fotoapparaten und Ferngläsern eingesetzt werden", so Prof. Heide, der leitende Wissenschaftler des Projekts.
Im neuen sechs mal sechs Meter großen und über fünf Meter hohen Sprengraum können bis zu 20 Kilogramm hochbrisanter Sprengstoff pro Experiment gezündet werden. Damit wird es möglich sein, für Materialsynthesen einen Druck von über 300 Gigapascal zu erreichen. Zum Vergleich: Würde man den Pariser Eiffelturm auf einer Fingerspitze balancieren, entspräche das einem Druck von zehn Gigapascal. Der Druck im Erdkern beträgt ca. 350 Gigapascal. Der Sprengraum ist 200 Kubikmeter groß und befindet sich in einer Tiefe von 150 Metern.
Das neue Schockwellen-Labor der Institute für Mineralogie und Anorganische Chemie der TU Bergakademie Freiberg ist ein Teil des Freiberger Hochdruckforschungskollegs (FHP) der Dr.-Erich-Krüger-Stiftung. Mit seinem neuen Sprengraum ist es weltweit das Größte, welches an einer Universität betrieben wird.
Der neue Sprengraum wurde seit 2010 von den Mitarbeitern des Lehr- und Forschungsbergwerkes erschlossen und bis heute nach und nach ausgebaut. Neben dem Sprengraum gibt es einen gesonderten Mess- und Kontrollraum sowie einen direkten Anschluss an die Grubenbahn.
Mit dem Lehr- und Forschungsbergwerk "Reiche Zeche" hat die Freiberger Universität für ein derartiges Labor einzigartige Bedingungen. So können Spezialsprengstoffe für wissenschaftliche Experimente unter Tage eingesetzt werden. Außerdem ermöglicht das Sprengen in großer Tiefe eine zeitnahe Versuchsdurchführung, da zahlreiche Auflagen entfallen, welche die Sprengarbeit über Tage einschränken.
Das neue Freiberger Schockwellenlabor bietet zusätzliche technologische Entwicklungsmöglichkeiten. Neben der Herstellung neuer Materialien werden auch bekannte Verfahren wie z.B. das Sprengplattieren und das Explosivumformen weiterentwickelt. Beim Plattieren werden z.B. zwei verschiedene Metallbleche miteinander verbunden, die sich auf anderem Wege nicht verschweißen lassen.