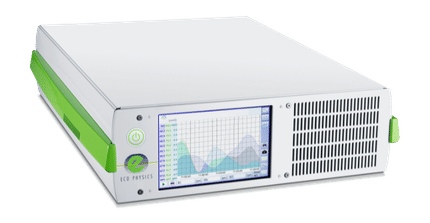| Eigenschaften
|
|
|
| Allgemein
|
| Name, Symbol, Ordnungszahl
| Ruthenium, Ru, 44
|
| Serie
| Übergangsmetalle
|
| Gruppe, Periode, Block
| 8, 5, d
|
| Aussehen
| silbrig weiß metallisch
|
| Massenanteil an der Erdhülle
| %
|
| Atomar
|
| Atommasse
| 101,07 u
|
| Atomradius (berechnet)
| 130 (178) pm
|
| Kovalenter Radius
| 126 pm
|
| Van-der-Waals-Radius
| - pm
|
| Elektronenkonfiguration
| [Kr] 4d75s1
|
| Elektronen pro Energieniveau
| 2, 8, 18, 15, 1
|
| 1. Ionisierungsenergie
| 710,2 kJ/mol
|
| 2. Ionisierungsenergie
| 1620 kJ/mol
|
| 3. Ionisierungsenergie
| 2747 kJ/mol
|
| Physikalisch
|
| Aggregatzustand
| fest
|
| Modifikationen |
|
| Kristallstruktur | hexagonal
|
| Dichte
| 12,37 g/cm3
|
| Mohshärte
| 6,5
|
| Magnetismus
|
|
| Schmelzpunkt
| 2607 K (2334 °C)
|
| Siedepunkt | 4423 K (4150 °C)
|
| Molares Volumen
| 8,17 · 10-6 m3/mol
|
| Verdampfungswärme
| 595 kJ/mol
|
| Schmelzwärme
| 24 kJ/mol
|
| Dampfdruck
|
1,4 Pa bei 2523 K
|
| Schallgeschwindigkeit
| 5970 m/s bei 293,15 K
|
| Spezifische Wärmekapazität
| 238 J/(kg · K)
|
| Elektrische Leitfähigkeit
| 13,7 · 106 S/m
|
| Wärmeleitfähigkeit
| 117 W/(m · K)
|
| Chemisch
|
| Oxidationszustände
| 2, 3, 4, 6, 8
|
| Oxide (Basizität)
| (leicht sauer)
|
| Normalpotential |
|
| Elektronegativität | 2,2 (Pauling-Skala)
|
| Isotope
|
| Isotop
| NH
| t1/2
| ZM
| ZE MeV
| ZP
| | 94Ru |
{syn.}
| 51,8 min | ε | 1,593 | 94Te |
| 95Ru |
{syn.}
| 1,643 h | ε | 2,572 | 95Te |
| 96Ru |
5,52 %
|
Stabil |
| 97Ru |
{syn.}
| 2,9 d | ε | 1,115 | 97Te |
| 98Ru |
1,88 %
|
Stabil |
| 99Ru |
12,7 %
|
Stabil |
| 100Ru |
12,6 %
|
Stabil |
| 101Ru |
17,0 %
|
Stabil |
| 102Ru |
31,6 %
|
Stabil |
| 103Ru |
{syn.}
| 39,26 d | β− | 0,763 | 103Rh |
| 104Ru |
18,7 %
|
Stabil |
| 105Ru |
{syn.}
| 4,44 h | β− | 1,917 | 105Rh |
| 106Ru |
{syn.}
| 373,59 d | β− | 0,039 | 106Rh |
|
| NMR-Eigenschaften
|
|
| Spin
| γ in
rad·T−1·s−1
| E
| fL bei
B = 4,7 T
in MHz
|
| 99Ru
| -3/2
| 9,068 · 106
| 0,000195
| 6,78
|
| 101Ru
| -5/2
| 1,322 · 107
| 0,00141
| 9,88
|
|
| Sicherheitshinweise
|
| Gefahrstoffkennzeichnung
|
|
|
| R- und S-Sätze
| R: 11}}}">{{{2}}}}}}">{{{3}}}}}}">{{{4}}}}}}">{{{5}}}}}}">{{{6}}}}}}">{{{7}}}}}}">{{{8}}}}}}">{{{9}}}}}}">{{{10}}}}}}">{{{11}}}}}}">{{{12}}}}}}">{{{13}}}}}}">{{{14}}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|
}}
}}
|
| S: 16-22-24/25}}}">{{{4}}}}}}">{{{5}}}}}}">{{{6}}}}}}">{{{7}}}}}}">{{{8}}}}}}">{{{9}}}}}}">{{{10}}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|
}}
}}
}}
|
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet.
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.
|
Ruthenium (von lat. ruthenia: „Russland“, das Heimatland des Entdeckers) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Ru und der Ordnungszahl 44.
Es handelt sich um ein seltenes Übergangsmetall der Platinmetalle.
Geschichte
Ruthenium (von Ruthenia, lateinisch für Russland) wurde 1844 von Karl Ernst Claus entdeckt und isoliert. Er zeigte, dass der in Königswasser unlösliche Rückstand von Rohplatin eine Verbindung eines neuen Elementes enthielt.
Jöns Jakob Berzelius und Gottfried Osann entdeckten Ruthenium schon 1827. Auch sie lösten Rohplatin in Königswasser und untersuchten den unlöslichen Rückstand. Während Berzelius kein ungewöhnliches Metall fand, war Osann überzeugt, gleich drei neue Metalle gefunden zu haben. Einem gab er den Namen Ruthenium.
Ebenso könnte der polnische Chemiker Jedrzej Sniadecki das Element 44, das er Vestium nannte, 1807 aus Platinerz gewonnen haben. Seine Arbeiten wurden aber nie bestätigt. Später zog er seinen Anspruch auf Entdeckung eines neuen Elementes zurück.
Vorkommen
Normalerweise kommt Ruthenium in Platinerzen aus dem Ural sowie Nord- und Südamerika verschwistert mit anderen Elementen der Platingruppe vor. Kleine, aber kommerziell interessante Vorkommen gibt es auch in Sudbury, Ontario (Pentlandit) und in südafrikanischen Pyroxinitlagerstätten.
Metallisches Rutheniumpulver wird in einem komplexen Prozess durch Reduktion von Ammonium-Ruthenium-Chlorid durch Wasserstoff hergestellt. Die Verdichtung zum kompakten Metall erfolgt durch pulvermetallurgische Verfahren oder durch Lichtbogenverschweißung unter Argon als Schutzgas.
Ruthenium könnte auch aus abgebrannten Brennelementen gewonnen werden, in dem es mit einen Anteil von einigen Prozent enthalten ist. Da das so gewonnene Ruthenium radioaktive Isotope mit Halbwertszeiten von bis zu einem Jahr besitzt, müsste das so gewonnene Ruthenium erst einige Jahre gelagert werden, bevor es den Kontrollbereich verlassen darf.
Eigenschaften
Ruthenium ist ein hartes, sprödes, grauweißes Metall der Gruppe der Platinmetalle, das in vier Kristall-Modifikationen vorkommt.
Bei Raumtemperatur behält es seine metallisch blanke Oberfläche und läuft nicht an. Beim Glühen im Sauerstoffstrom bildet sich flüchtiges, unbeständiges und giftiges Rutheniumtetraoxid, das durch Lichteinwirkung explosiv in Rutheniumdioxid und Sauerstoff zerfallen kann.
Ruthenium ist in allen mineralischen Säuren unterhalb von 100 °C beständig, löst sich aber in Alkalischmelzen, besonders wenn zusätzlich oxidierend wirkende Verunreinigungen wie Natriumperoxid Na2O2 und Natriumchlorat NaClO3 vorhanden sind. Bei höheren Temperaturen wird es auch von Halogenen oxidiert.
Zum Härten von Platin und Palladium wird es in kleinen Mengen zulegiert.
In Titanlegierungen erhöht eine Konzentration von 0,1 % Ruthenium die Korrosionsbeständigkeit drastisch.
Plattierungen aus Ruthenium können elektrolytisch wie auch durch thermische Zersetzung hergestellt werden.
Eine Ruthenium-Molybdän-Legierung ist supraleitend. Die Sprungtemperatur beträgt 10,6 K.
Ruthenium kommt in den Oxidationsstufen -2 und +1 bis +8 vor, meist aber nur die Stufen +2, +3 und +4.
Anwendungen
- Elektrischen Schaltkontakten aus Platin und Palladium wird Ruthenium zur Erhöhung der Verschleißfestigkeit zulegiert
- Legierungszusatz in Titanlegierungen (siehe oben)
- Ruthenium kann als vielseitiger Katalysator eingesetzt werden
- Mit Rutheniumdioxid beladenes Cadmiumsulfid kann in wässriger Lösung Schwefelwasserstoff durch Licht zersetzen
- Metallorganische Rutheniumkomplexe weisen tumorhemmende Eigenschaften auf, sog. Ruthenium-Applikator (RU-106 Strahlenträger) in der Strahlen-/Tumortherapie
- In der Galvanotechnik wird Ruthenium zur dekorativen Veredelung von Oberflächen benutzt
- Ruthenium wird in letzter Zeit zunehmend auch zur Schmuckproduktion verwendet
- Als wenige Atomlagen dicke Beschichtung in Festplatten
- Wichtiges Metall für das weitere Verkleinern (Shrinken) von integrierten Schaltkreisen (Chips)
- Derzeit sind Solarzellen in Entwicklung, die eine Ruthenium-Beschichtung aufweisen und die in der Photovoltaik vorherrschenden Silicium-Zellen dank höherem Wirkungsgrad teilweise ersetzen könnten
Vorsichtsmaßnahmen
Rutheniumtetraoxid RuO4 ist wie das Osmiumtetraoxid hochtoxisch und explosiv.
Ruthenium hat keine biologische Funktion. Es erzeugt Hautflecken und reichert sich im Knochen an. Eventuell ist es krebserregend. Metallisches Ruthenium ist fein verteilt als Pulver oder Staub leicht entzündlich, in kompakter Form aber nicht brennbar.
Verbindungen
Rutheniumverbindungen sind den Cadmiumverbindungen sehr ähnlich. Es existieren mindestens acht Oxidationsstufen. Meist liegt es aber in den Stufen +2, +3 und +4 vor. Es hat eine reiche Koordinationschemie, wobei der bekannteste Komplex wohl das Ruthenium(II)tris(bipyridin) ist.
Literatur
Prechtl, Martin H.G.(2007): Novel Ruthenium Dihydrogen Complexes and their Application in Catalyses. Duisburg & Köln: WiKu-Verlag Dr. Stein. ISBN 978-3-86553-229-9.
|